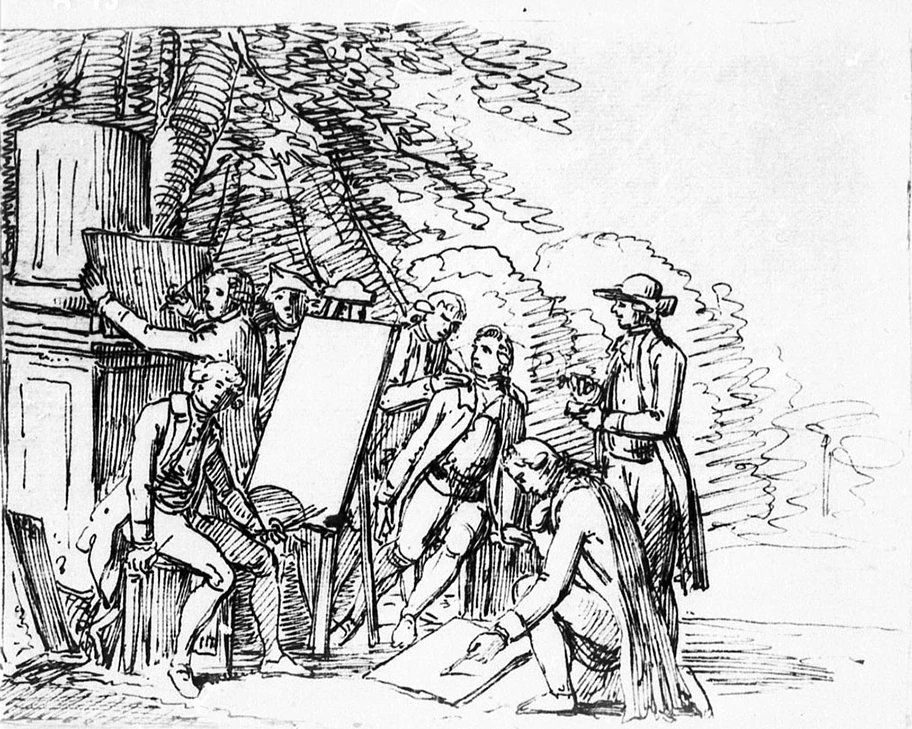Der klügste Schachzug des alten Goethe freilich war, dass er weder auf die Physik als Wissenschaft von der Struktur und den Bewegungsgesetzen der nicht belebten Materie noch auf Isaak Newton (1643-1727) als Begründer der modernen mathematischen Physik und physikalischen Astronomie im generellen und schon gar nicht speziell auf dessen Farbenkreisel einging. Sondern dass er im Text nur allgemeinantipodisch auf seine eigene „Lehre des Lichts und der Farben“ verwies. Auch dies lässt sich als didaktischer Hinweis des literarischen Klassikers und sensualen (Natur-) Wissenschaftlers als eine seiner Grundüberzeugungen lesen: Naturerscheinungen lassen sich weder auf Kern und Schale zurückführen noch jemals vollständig berechnen …
I.
Veröffentlichungen des österreichischen Fachphilosophen und kybernetischen Systemtheoretikers Peter Heintel (*1940) erinnern sowohl an die (hier nur kurz angesprochene) klassische Grundthese Goethes als auch an die grundlegende Subjekt-Objekt-Problematik.Der Klagenfurter Lehrstuhlprofessor kritisiert(e) aus kritischer Sicht einen alternativlos erscheinenden Status Quo mit seinen objektivierten Systemimperativen und plädierte zugleich, auch als Beitrag zur theoretisch-sozialphilosophischen und praktisch-sozialwissenschaftlichen Forschung, für Brüche mit diesem hermetischen Objektivismus durch grundlegende Subjektivierung gemeinsam mit Wilhelm Berger (1989) grundlegend auf einer allgemeinen sozialphilosophischen Ebene: „für die Philosophie genügt es nicht, beim Nichts angelangt zu sein.
Man braucht neue Sicherheiten und Verbindlichkeiten und eine neue Organisationswahrheit“; systemtheoretisch (1988) für ein neues historisches, gegen alle Entsubjektivierung(en) kämpfendes Subjekt. Dieses soll sowohl die nicht mehr systemrelevanten vereinzelten Subjekte als „vereinzelte einzelne“ (Karl Marx) organisierend aktivieren als auch die unter Weiterentwicklung seiner Teilsysteme zunehmend nicht mehr kontrollierbare, wahrscheinlicher werdende Selbstvernichtung des Hauptsystems umkehrbar machen. Auf der dritten Ebene konkretisierte Heintel (2005) seinen entobjektivierenden Ansatz als im Feld des Subsystems Wissenschaft angesiedeltes operatives Programm einer neuen subjektivierten Wissenschaft.
II.
Heintels Vorstellungen vom historischen Subjekt zur Herstellung von Aktions- oder Handlungsfähigkeit(en) des gegenwärtig zur „historischen Ohnmacht verurteilten“ gesellschaftlichen Handlungssubjekts bleiben freilich leider sprachlich vage, theoretisch abstrakt und praktisch dilemmatisch. Alle zu Recht eingeforderte historische Subjektivierung mit neu zu entfaltender „gestaltender Subjektivität“ verbleibt in der abstraktesten „Subjektwerdung aller Menschen“ und entbehrt damit jeglicher sozialer Differenzierung und gesellschaftlicher Präzisierung.Die „Subjektwerdung aller“ als „Ziel einer historischen Menschheitsentwicklung“ appelliert an das Gattungsvermögen der Species, wird mit Systemwidersprüchen, von denen „alle Systeminsassen mehr oder weniger betroffen sind“, begründet und nennt zugleich keinen einzigen, angeblich alle betreffenden, systemtranszendierenden Widerspruch und seine praktische Organisationsmöglichkeit. Insofern ergibt Heintels Option einer neuen Menschheit jenseits des Prinzips Hoffnung nur handlungseunuchisches Harren auf das systemtheoretisch bekannte und Naturgesetzlichkeit beanspruchende Prinzip Evolution, genauer: Warten darauf, dass „etwas an sich Unwahrscheinliches wahrscheinlich gemacht wird“, dass „etwas Unwahrscheinliches situativ, spezifisch wahrscheinlich wird“ und dass es zur historischen „Subjektwerdung“ aller Menschen Evolution als „Umformung von Entstehungsunwahrscheinlichkeit in Erhaltenswahrscheinlichkeit“ (Niklas Luhmann)[1] geben möge.
III.
So kritisch betrachtet, wird Heintels auf der Klagenfurter Tagung „Tönnies im Gespräch“ (2004) lebendig vorgetragener operativer Ansatz Über eine neue Wissenschaft umso wichtiger – nimmt er doch den anspruchsvollen Gesichtspunkt „Umkehr der Verhältnisse, neues Erkennen und Begreifen“ als „Subjektivierung der bisherigen Forschungsobjekte“ aus der Organisation der Philosophen (1998) wieder auf und geht auch über bisherige progressive Ansätze, etwa forschungsrelevanter Gruppendiskussionen, responsiver Evaluierungen und (methodologisch bisher unbearbeiteter) Aktions- und Handlungsforschungen hinaus.Heintels Ausgangspunkt ist die nicht nur für Geschichtsschreibung wirksame Identitätsillusion des Wie-es-doch-war. Nachvollziehbare Kritikpunkte anwendungsbezogener (Natur-)Wissenschaft, aller dominanter Wissenschaftspraxis mit ihrer „Herrschaft der Quantität“ und dem galileischen Grundsatz „Was messbar ist, messen; was nicht messbar ist, messbar machen“ sind Messbarkeit, Objektivierung, Spezialisierung, Logik, Kausalität, definiter Raumzeitlichkeit, Analytik, Sichtbarkeit und expertenbestimmte Arbeitsteilung. Darauf beruhen szientifische Selbstideologisierungen als Weiterführung der Identitäts-illusion: „die sogenannte Wertfreiheit als Entsubjektivierung, die Evidenz der Axiome, die Verschleierung der Idealtypik der jeweiligen experimentellen Situation“.
Dem hält Heintel das Kant'sche Apriori als Prinzip der Autotranszendenz entgegen: „wir selbst sind transzendent als Voraussetzung all unserer Erkenntnis“, genauer: „Dieses Vergessen der Selbsttranszendenz hat eine der wichtigsten Konsequenzen im Rahmen dessen, was unsere Wissenschaftsentwicklung ist.“ Als „weiteren Mangel“ nennt Heintel den Verlust „kollektiv verbindlicher Weltinterpretationen“ besonders religiöser Prägung(en): Die Religion habe es „aufgegeben, sich um irdische Belange zu kümmern und die Physik wurde in ihre Nachfolge gebracht.“
IV.
Nach kritischen Hinweisen auf spezielle Deformationen in den Subsystemen Wissenschaft[2] („Die Wissenschaft gesteht ja nur unter der Hand ein, dass auch sie Rituale hat, die mit Wissenschaft nichts zu tun hätten“) und Medienöffentlichkeit als jener „aufwändiger Verdummungsindustrie mit ihren Verblendungs-, Verkehrungs-und Umwertungsmechanismen“ zur Herstellung „gesellschaftlicher Gefolgschaft“[3] und ihrem exponentiell anwachsenden Sprachmüll, „wenn etwa Kriegshandlungen so erklärt werden, als hätten sie mit Krieg nichts mehr zu tun (wie ,humanitäre Intervention' und ,Präventivmassnahmen')“ konzentriert sich Heintel auf die von ihm propagierte neue Wissenschaft vom Lebendigen zur Aufhebung der Subjekt-Objekt-Trennung im Sinne einer „zweiten Aufklärung“:„Weil die klassische Wissenschaft sich im Gedanken der Aufklärung auch noch der Dominanzfigur der Naturwissenschaften angeschlossen hat, ist sie relativ ohnmächtig […] Die Axiome müssen neu entschieden werden, zum Beispiel ist nicht alles messbar. Was macht man, wenn etwas nicht messbar ist? Was macht man mit den Widersprüchen, wenn man sie gelten lässt? Was macht man mit dem Faktum der Aufhebung der Verobjektivierung? Das nennen wir Interventionsforschung. Es geht dabei darum, dass Wissenschaft problem-, system- und menschenbezogen die Arbeitsteilung aufhebt, die sie sich als spezialisierte gegeben hat, im Zusammenhang mit endlicher Wahrheit (Religion) und endlicher Forschung.“
Forschungsgegenstand und Sujekt dieser entobjektiviert-subjektivierten Interventionsforschung als Ausdruck einer neuen Wissenschaft des Lebendigen mit und für Menschen als erweiterte „Menschenwissenschaft“ (Norbert Elias) werden „Menschen und ihre Systeme“ im Doppelsinn von (projektiv-zukunftsorientiertem) Verändern und (retrospektiv-späterem) Erklären[4]. Es geht – so Heinelt im Schlussakkord – „nicht mehr nur um Erkenntnis, sondern um die Gestaltung von Entscheidungsprozessen, in denen die verschiedensten Wissenschaften ebenso wie die Beteiligten an sektoriellen Grenzüberwindungen […] teilnehmen. Es geht also vom Gegenstand zum Prozess, den man begleitet.“