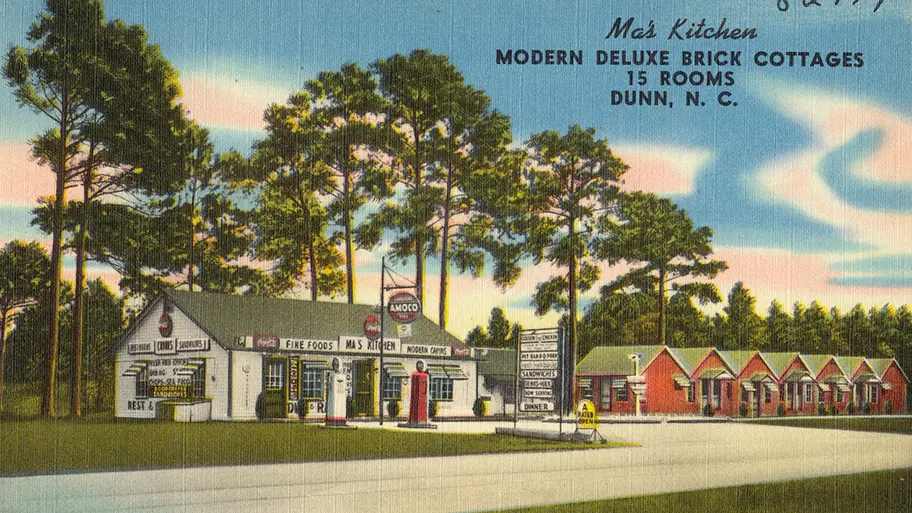Manche kaufen Billigkleidungsstücke, die nach kurzer Zeit verschleissen, und orientieren sich an einem Novitätskult („Hauptsache was Neues, Hauptsache Abwechselung“). Ein anderer Teil der Bevölkerung schätzt allerdings besser verarbeitete Kleidungsstücke und ist bereit (und genügend zahlungskräftig), für das einzelne Exemplar, das länger hält und ansehnlich bleibt, einen höheren Preis zu zahlen.
Trotz der verbreiteten kritischen Aufmerksamkeit für Praktiken des geplanten Verschleisses hat sich noch keine kampagnen- und interventionsfähige soziale Bewegung formiert. Am Ausmass des Problems kann das nicht liegen: „Müssten die Verbraucher nicht ständig neue Produkte kaufen, weil die alten zu früh kaputtgehen, blieben ihnen im Jahr 100 Milliarden € übrig“ (Süddeutsche.de, 20.3.2013). Vgl. die umfassende Studie von Kreiss 2014.
Collaborative consumption
Das Internet erleichtert es, Kleidungsstücke weiterzugeben oder zu tauschen. Eine Studie im Auftrag des Privatunterkunftsvermittlers „Airbnb“ hiess „Deutschland teilt“. Ihr zufolge praktizierten vor 10 Jahren bereits 12% aller Deutschen „geteilten Konsum im Sinne des gemeinsamen Organisierens und Konsumierens über das Internet. Bei den 14- 29-Jährigen seien es sogar 25%. ‚Die jüngere Generation hat die Vorteile einer Ökonomie des Teilens wiederentdeckt und belebt sie dank Internettechnologie neu', sagt Prof. Harald Heinrichs von Leuphana-Universität Lüneburg, der an der Untersuchung mitgearbeitet hat“ (Fiedler 2013).Die Internet-Portale dürfen nicht umständlich sein. „Wenn ich z.B. beim Nachbarschaftsportal nebenan.de täglich einen Berg von Nachrichten bekomme und nur ein oder zwei konkrete Anfragen zum Teilen dabei sind, habe ich schnell keine Lust mehr“, so der Konsumexperte Carl Tillessen (zit. n. Vangelista 2023). Klare Regeln sind erforderlich, wer im Streitfall zuständig ist. „Die Deutschen nutzen die Angebote der Sharing Economy deutlich seltener, als es in manch anderen Ländern üblich ist. In den Niederlanden sind es etwa 16% der Menschen, in Grossbritannien sogar 30% und in Australien 38%“ (Vangelista 2023). Die Sharing-Ökonomie hat auch ihre Schattenseiten. Bspw. können die Mitglieder einer Wohngemeinschaft ihre Kosten dadurch verringern, dass sie ein Zimmer nicht mehr an ihresgleichen vermieten, sondern zu höherem Preis an Touristen oder andere Kurzzeitgäste. Das Angebot an Autos, die man unaufwändig ausleihen kann, erleichtert die Nutzung des Autos als Verkehrsmittel, erhöht dessen Gebrauch und verringert zugleich die Zahl der Fahrzeuge.
Das Verhältnis zwischen Arbeit und Konsum sowie zwischen Produzenten und Konsumenten
Es verändert sich etwas in der Gesellschaft, wenn Konsumenten sich klarmachen: Die Arbeit in Fabriken und Supermärkten zur Produktion und zum Verkauf von Konsumgütern ist gegenwärtig häufig für die Arbeitenden unattraktiv. Wir klammern an dieser Stelle mögliche Umgestaltungen der Arbeit unter anderen gesellschaftlichen Verhältnissen aus, die die Qualität der Arbeitszeit als Lebenszeit erhöhen (Vgl. dazu Creydt 2021). In einer anstrebenswerten Gesellschaft des guten Lebens würden Konsumenten nicht nur aus ökologischen Beweggründen, sondern auch aus dem Bewusstsein für die massiv negativen Folgen der unattraktiven Arbeit für die Arbeitenden weniger Produkte nachfragen.Die Einstellung würde sich verändern. Meinen Genuss am Produkt setze ich dann ins Verhältnis zu dem, was ich anderen damit zumute. Damit würde eine in der bürgerlichen marktwirtschaftlichen Gesellschaft herrschende Kernspaltung sich gravierend verringern. Die Gleichgültigkeit zwischen dem Individuum als Konsument und als Werktätiger stellt nicht nur ein Verhältnis zwischen verschiedenen Individuen dar. Es handelt sich wenigstens dann um ein Verhältnis innerhalb ein und desselben Individuums, wenn es sowohl in die Erwerbsarbeit eingespannt wird als auch als Konsument auftritt.
Zur Veränderung des Verhältnis zwischen Arbeit und Konsum trägt auch eine andere Entwicklung bei. Bei einem Teil der Zeitgenossen greift die Einsicht um sich, dass auch eine noch so schöne Freizeit weder die Entbehrungen und Frustrationen noch den Mangel an menschlicher Entwicklung innerhalb der Arbeitszeit zu kompensieren vermag.
Der soziale Bezug auf andere Menschen verändert sich auch durch geteilten Konsum. Wenn in einem Wohnblock die Nachbarn gemeinsam bestimmte Werkzeuge verwalten oder entsprechende Ausleihstationen frequentieren, sparen sie nicht nur Kosten, sondern kommen auch anders untereinander in Kontakt. Und es verringert sich der Besitzindividualismus, mit dem jeder sich ein teures Kleinreich privaten Eigentums einrichtet und es eifersüchtig vor den Nachbarn hütet. Gewiss braucht es für die gemeinsame Verwaltung gemeinsamer Güter kollektive Regeln und Sanktionen bei Zuwiderhandlung.
Vor allem aber bedarf es eines Bewusstseinswandel. Die Vorteile privater Verfügbarkeit werden ins Verhältnis gesetzt zu den materiellen und immateriellen „Kosten“ an unattraktiver Arbeit. Sie wird solange in einem absurden Übermass erforderlich, wie jeder Haushalt meint, sich privat Gerätschaften und Maschinen zulegen zu müssen, die in der Nachbarwohnung oder im Nachbarhaus ebenfalls in 95% der Zeit ungenutzt herumstehen. Die Bohrmaschine bringt es in US-Amerikanischen Haushalten in ihrer „Lebenszeit“ auf 14 Minuten Aktivität.
Die für die Arbeitenden unattraktive Arbeit sowie die Sozialverhältnisse von Konkurrenz, Neid, unten/oben-Statusvergleich und gegenseitiger Isolation sind belastend bzw. schädlich. Das Ansinnen, diese Misere individuell per überkompensatorischem Konsum und exquisiter Freizeitgestaltung vergessen zu wollen, gleicht der Münchhausiade, sich selbst am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. In dem Masse, wie dies bewusst wird, wandelt sich auch das Bewusstsein für das, was im Leben wichtig ist. Der Drang verringert sich, immer wieder andere Novitäten wertzuschätzen, nach Events süchtig zu werden und immer stärkere Reize nachfragen zu müssen. Eine stark umstrittene Frage in der Diskussion um Alternativen zur modernen bürgerlichen Gesellschaft mit kapitalistischer Ökonomie lautet: Welchen Stellenwert sollen bzw. müssen Märkte in ihr haben? Die einen sagen: Marktwirtschaft ist als Regulationsmechanismus unvermeidbar. Andere weisen auf das „Marktversagen“ hin und auf die psychosoziale Bilanz von Märkten: Sie erziehen zu Konkurrenz, zur Gleichgültigkeit zwischen Konsumenten und Produzenten sowie zur Ausblendung desjenigen, was nicht bepreisbar ist. Ohne diese Kontroverse hier direkt zu diskutieren, nähern wir uns ihr indirekt: Werden Güter gemeinsam genutzt, so verringert sich die Nachfrage nach ihnen und damit auch die Relevanz von Märkten. Über Gemeingüter wird gemeinsam oder öffentlich entschieden.
Das setzt eine Ökonomie voraus, in der die Arbeitsplätze davon abhängig sind, dass gesellschaftlich Sinnvolles geschaffen wird. In der kapitalistischen Wirtschaft lässt sich den produzierten Gebrauchswerten anmerken, dass sie immer mehr nur deshalb produziert werden, um das Kapital zu verwerten. Dann kommen die Produzenten schon insofern in eine perverse Interessenidentität zum Kapital, als eine vernünftige Neustrukturierung des Konsumierens und des Arbeitens erst einmal viele der bestehenden Arbeitsplätze unnötig macht. Nur unter der Herrschaft der kapitalistischen Kriterien des Reichtums entsteht damit Arbeitslosigkeit.
Der Kult der privaten Küche und öffentlich subventionierte Speisegaststätten
Die Ernährung stellt eine enorm umfangreiche und massgebliche Angelegenheit dar. Und zwar sowohl für die Nachfrage nach Konsumgütern als auch für die Reichweite von Märkten in der Gesellschaft. Zugleich handelt es sich um ein Thema, das Fragen nach der individuellen Lebensweise aufwirft. Entsprechend kontrovers sind die Auffassungen.Unstrittig ist es problematisch, wenn viele Deutsche Fastfood konsumieren, sich hochverarbeitete und damit gesundheitlich abträgliche Fertiggerichte aufwärmen und wenig Aufmerksamkeit für die Qualität ihrer Nahrung haben. Mit dem Kochen kann man es aber auch übertreiben. Ein Motiv dafür ist die Selbstbemutterung: „Wenigstens hier kann ich etwas Gutes für mich tun und das lass ich mir nicht nehmen.“ Die Kochshows seit den 1970er Jahren und der Kult der Selbstsorge haben dem Kochen eine künstliche Bedeutung verliehen. Es bildet nun eine Teilmenge der Subjektivierung des Lebens. Ihr zufolge soll jeder Person nicht nur ökonomisch ein selfmade-man sein, sondern Schmied seines eigenen Glücke. Das Kochen gilt als Handlung, die symbolisiert, dass man seines leiblichen Wohlergehens eigener Herr sei.
Das Kochen ist für viele zu einer überkompensatorischen Domäne von Kenner- und Könnerschaften geworden. Leute mit dem nötigen Kleingeld investieren in Küchen gern viel. Es findet sich eine Ausstattung, die angesichts des Personenkreises, dem das Kochen zugute kommt, unverhältnismässig aufwendig ausfällt. Die Utensilien sollen den Ansprüchen von Sterneköchen gehorchen.
Die Küche wird dann zum Statussymbol. „Die Küche ist das neue Auto. Das schreibt die ‚WirtschaftsWoche‛, das stellen Trendsetter und Wohnzeitschriften fest. Und die deutsche Küchenindustrie freut es. Sie verzeichnet nämlich 30 Prozent Zuwachs, vornehmlich im hochwertigen Ausstattungssegment. […] Als Statussymbol löst sie (die Küche – Verf.) schon seit einiger Zeit das Auto ab.“
Geschmacksniveau, Lebensstil und -kunst gilt es zu zelebrieren, wenn man sich gegenseitig zu exquisiten Gerichte einlädt bzw. von ihnen schwärmt: „Frittierte Kolibri in Brennesselmousse“ (Rutschky 1987, 169) und zum Nachtisch gepeitschte Wanze in Aspik. Das Bürgertum hat alles Heilige in Profanes verwandelt. Wer aber nun anfängt, Profanem die Würde des Heiligen zuzuschreiben, verrennt sich in Verstiegenheiten und verwirrt die Aufmerksamkeit für Wertmassstäbe.
Viele sind davon gestresst, täglich ein warmes Essen für den Partner oder die Kinder auf den Tisch zu bringen. Anders als bei begeisterten Freizeitköchen resultiert das private Kochen häufig nicht aus einer individuellen Vorliebe, sondern eher aus einer gegenwärtig dominierenden Zwangs- und Mangelsituation: Der Besuch eines Restaurants ist zu teuer. Gute Kantinen sind selten. Wenn sich hier das Angebot zum Guten verändert, werden viele vielleicht nicht darauf bestehen wollen, privat zu kochen. Andere Personen, die das unbedingt wollen, können ihrem Hobby nachgehen.
Das Missverhältnis zwischen grossindustriell produzierter Nahrung und der Verarbeitung der Produkte für die Nahrungsaufnahme in privaten Küchen könnte kaum grösser sein. Ein Vergleich mit anderen Konsumgütern verdeutlicht das: Fast niemand kommt auf die Idee, sich die notwendigen Materialien einzeln zu kaufen, um aus ihnen eigenhändig sich das eigene Schuhwerk anzufertigen. Viele schätzen ihre eigenen Kochkünste als Fähigkeiten und Sinne. Sie sehen dabei nicht nur auf deren funktionalen Nutzen, sondern erachten das Kochen als Teil ihrer ganz persönlichen Kultur. Zugleich gilt es diese legitime Perspektive ins Verhältnis zu setzen zu dem, was das private Kochen voraussetzt. Es verbraucht nicht nur im Übermass Ressourcen,.
Die in der bürgerlichen Gesellschaft dominierende Kultur der privaten warmen Mahlzeit zieht einen Rattenschwanz an problematischen Konsequenzen nach sich. Das Kochen im Kleinsthaushalt fordert nicht nur einen gesamtgesellschaftlich hohen Einsatz von Arbeit im Vergleich zur Erstellung von Mahlzeiten in einem Restaurant. Würden preiswerte und qualitativ leistungsstarke, gesellschaftlich subventionierte Speisegaststätten in Laufreichweite der Wohnung existieren, so müssten viel weniger Lebensmittel in Geschäften eingekauft werden.
Nicht nur der Aufwand der Konsumenten fürs Einkaufen würde sinken, sondern auch das Ausmass der wenig attraktiven Tätigkeiten in Supermärkten. Der Aufwand bei den Zulieferern, die Lebensmittel in jeweils kleiner Menge zu verpacken, damit sie individuell transportiert und gelagert werden, würde massiv abnehmen. (Ich folge in den letzten drei Absätzen Überlegungen von Ulf Petersen.) Die damit verbundene Reduktion der Arbeiten der Verpackungsindustrie wäre begrüssenswert – nicht nur aus ökologischen Motiven, sondern auch aus Gründen der Reduktion unattraktiver Arbeit.
Die Kleinfamilie überschreiten
Gewiss würde sich mit der Verlagerung des Kochens vom heimischen Herd ins Restaurant auch etwas an der Kultur der Privatheit verändern. Für eine solche Transformation sprechen ebenfalls andere Gründe:Um die Enge der Kleinfamilie (vgl. Creydt 2023) zu überwinden sind „Netze aus freundschaftlichen Verwandten oder familiären Freunden“ förderlich (Steckner 2018, 105). Über die Kleinfamilie hinaus gilt es „auch andere Formen des verbindlichen Füreinander-da-Seins“ zu schaffen (Ebd., 104). Das geht nicht allein im privaten Do-it-yourself. „Damit Familienalltag kein privates Hexenwerk bleibt, braucht es auch kommunale Orte, an denen die Haus- und Reproduktionsarbeit gemeinsam stattfinden kann: […] Kinderhäuser, in denen Erwachsene höchstens absichernd anwesend sind, Vorlesenachmittage mit rüstigen Wahlopas, Care-Stationen, wo Familien bei der Hege und Pflege alter oder kranken Angehöriger unterstützt werden […], mehr gute Volksküchen. […] Jede braucht mal Rückzug. Aber ist wirklich in jedem Einzelhaushalt eine Waschmaschine vonnöten?“ (Ebd.).
Nachbarschaft fördernde Wohnformen können dazu beitragen, die kleinfamiliäre Einengung des Umfeldes von Kindern sowie Eltern zu überwinden. Soziale Netzwerke, die die Erziehung und die Betreuung von Kindern betreffen, gilt es zu fördern und auszubauen. Auch entsprechende Wohnformen helfen, die Isolation von „Alleinerziehenden“ und Alleinlebenden sowie den Mangel von Kinderlosen an Kontakt zu Kindern zu verringern. „Seit längerem entstehen zwar Beispiele für das ‚verbundene Wohnen' in Form von Gemeinschaftssiedlungen oder Hausgemeinschaften, die länger Bestand haben als vorübergehende Zweck-Wohngemeinschaften. Dass sie sich nicht viel breiter durchsetzten, liegt zum Teil an einem ungenügend ausgebauten Genossenschaftsrecht, hauptsächlich jedoch an den bestehenden Eigentumsverhältnissen.“
Wo nicht gemeinsam über Boden, Gebäude und Wohnungsbau verfügt werden kann, sind „neue Wohnstrukturen nur beschränkt realisierbar. Und für Immobilienbesitzer sind Anlagen mit Gemeinschaftsflächen oder -räumen weniger rentabel als herkömmliche Wohnungen oder Luxusappartements“ (Meier-Seethaler 1998, 384f.). All diese Prozesse verringern den subjektiven Drang, in der Kleinfamilie „unter sich bleiben“ zu wollen.
Der Kult des Eigenheims und der Wohnung
Ökologisch stellt die Vergrösserung der Wohnfläche pro Person ein massives Problem dar. Starke Vorbehalte gegen das Eigenheim resultieren aus der Kritik an der Zersiedelung, an der Versiegelung von immer mehr Boden und am absurden Verhältnis zwischen Wohnfläche und Aussenwänden bei einem frei stehenden Einfamilien-Haus. Aber auch hier gibt es eine andere Perspektive. Sie beurteilt etwas nicht nur unter dem Aspekt, ob es halbwegs gedeihliche ökologische Lebensbedingungen fördert oder schadet.Erstens würde eine andere Betrachtungsweise vergegenwärtigen, das die Errichtung grösserer Mehrfamilienhäuser in Summe weniger unattraktive Arbeiten erforderlich macht als der Bau vieler kleiner Einfamilien-Heime. Zweitens stellt sich auch hier die Frage nach der Qualität des Lebens selbst auf eine besondere Weise. Zur Konkurrenz in der bürgerlichen Gesellschaft gehört die Distinktion. Man will anderen und auf diesem Umweg sich selbst beweisen, als vereinzelter Einzelner trotz aller vermeintlich nur „äusseren“ bzw. gesellschaftlichen Unbilden ein gelingendes Leben zu führen.
Viele wollen als Connaisseure, Bonvivants oder Lebenskünstler subjektiv sich als so reich fühlen oder aufführen, dass die gesellschaftliche Objektivität in ihrem Aufmerksamkeitshorizont an den Rand rückt. Dazu gehört auch der Kult des Eigenheims (vgl. Bourdieu 1999) oder der privaten Wohnung. Viele treiben einen grossen Aufwand, um aus ihr ein höchst persönliches Gesamtkunstwerk zu machen. Im Unterschied dazu wiesen die Wiener Gemeindewohnungsbauten der 1920er Jahre eher kleine Wohnungen auf bei grosszügig vorgehaltenen Räumen für die Nutzung durch alle Bewohner. Angesichts des Kaputtsparens öffentlicher Einrichtungen haben viele heute keine Vorstellung davon, wie kollektivere Formen der die Lebensqualität erhöhen können.
Viele befürworten gegenwärtig die Verringerung der Menge an Produkten und Arbeiten aus ökologischen Motiven. Die Gesellschaft kommt dann nur als äussere Bedingung in den Blick. Gesellschaftliche Strukturen sollen so beschaffen sein, dass sie die natürlichen Bedingungen menschlichen Lebens nicht unumkehrbar beschädigen. Die Durchschnittstemperatur soll nicht weiter steigern, das Wasser nicht knapp werden, die Gülle es nicht massiv vergiften und ungefilterte Sonneneinstrahlung nicht Hautkrebs fördern. Sich dafür zu engagieren ist bitter notwendig. Entsprechende Bewegungen für den Schutz vor Katastrophen stellen die Frage nach der eigenen Qualität der Gesellschaft jedoch nur instrumentell. Sie kommt nur als ein Faktor in den Blick, der für etwas anderes relevant bzw. funktional ist – die Erhaltung halbwegs gedeihlicher klimatischer Bedingungen menschlichen Lebens. Anders verhält es sich, wenn die Frage lautet: In welcher Gesellschaft wollen wir leben?
Schluss
Die Befreiung der Konsumgüter, des Kochens und der Kindererziehung aus der Privatform bildet eine Teilmenge einer grösseren Transformation – der Veränderung der sozialen Beziehungen und gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Konsumgüter, das Kochen und die Kindererziehung stellen Themen dar, an denen sich neue Beziehungen zwischen Personen bilden und sich kollektivere gesellschaftliche Praxen einrichten lassen. Das stärkt die Assoziation der Menschen und emanzipiert sie von ihrer Vereinzelung und dem Ausgeliefertsein an anonyme Marktprozesse. Es geht darum, die Gesellschaft zu re-sozialisieren, also in ihr mehr Sozialität, mehr bewusst gestaltete prosoziale Lebensformen zu schaffen.In dem Masse, wie Strukturen und Institutionen dies ermöglichen und fördern, wird die Gesellschaft zu etwas, das nicht nur die Lebensbedingungen von Menschen bereitstellt. Vielmehr sehen die Individuen ihre Sozialität als für ihre eigene Lebensqualität wesentlich an. Das schliesst ein, die Gesellschaft so einzurichten, dass sie ihre Gestaltung nicht an Marktprozesse abgeben, die sich gegen die Bevölkerung verselbständigen.